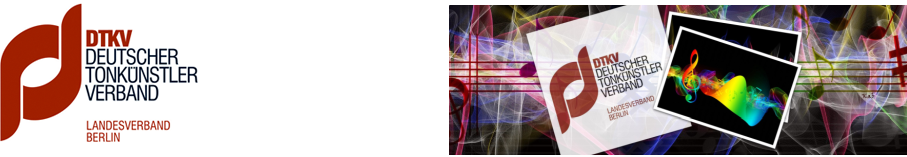News
21. März 2012
Was in der Kulturförderung falsch läuft
Eine Rezension von Wolfgang Böhler, "www.codexflores.ch":http://www.codexflores.ch
Im (…) Magazin «Der Spiegel» haben die vier Autoren Dieter Haselbach, Armin Klein, Pius Knüsel und Stephan Opitz ihr Buch «Der Kulturinfarkt» zusammengefasst. Damit haben sie schon vor der Verfügbarkeit des ganzen Textes viele gegen sich aufgebracht. Ihre Thesen sind jedoch wichtig. Sie kommen zur richtigen Zeit, stellen die richtigen Fragen und machen im Kern auch wegweisende Reformvorschläge.
Sie haben es vermutlich geahnt. Von der Heftigkeit der Reaktionen dürften die Autoren aber doch überrascht worden sein. Einhellig werden ihre Thesen als angeblich neoliberales Nützlichkeitsdenken gebrandmarkt, sie selber als zynische Wasserträger der Kulturabbauer, als Nestbeschmutzer denunziert. Selbst die sonst gerne zur Besonnenheit mahnende Feuilleton-Redaktion der NZZ sah sich veranlasst, im Kollektiv auf einer ganzen Seite noch vor der Publikation einer Rezension des Buches sich von vermeintlichen Simplifizierungen, «krausem Denken», von diesen «Schafen im Wolfspelz» zu distanzieren. Es wird mal wieder hyperventiliert.
Die kollektive Wut der «Kulturschaffenden» hat auch bereits ein erstes Opfer gefunden: Dieter Haselbach sah sich veranlasst, seine Tätigkeit als Geschäftsführer des Zentrums für Kulturforschung «zu dessen Schutz» auszusetzen. Einige Kombattanten schlügen nun auf das Zentrum ein, schreibt er in einer offiziellen Erklärung, wo sie ihn als Mitautor des Buches meinten. Das Zentrum sei kein politisch beratendes Institut und er wolle nicht, dass die Institution Schaden nehme.
Was löst derart Emotionen aus? Gegen Schluss zeichnet das Buch als Gedankenexperiment nach, was geschehen würde, schlösse man die Hälfte der staatlich geförderten Kulturinstitutionen. Aus der Zusammenfassung im «Spiegel» haben einige Kritiker, ohne genau zu lesen, fälschlicherweise abgeleitet, die Autoren wollten die staatlichen Kulturausgaben halbieren oder «geistfeindliches Marktdenken» installieren. Aber worum geht es wirklich?
Die Essenz einer künftigen Kulturpolitik sehen die Autoren darin, «vielfältigste Möglichkeiten zum Produzieren zu schaffen, das Individuum vom ästhetischen Imperativ der bürgerlichen Aufbruchszeit zu befreien, ihm ganz demokratisch die ästhetische Arbeit am eigenen Glück zu ermöglichen, wie immer dieses beschaffen ist.» (214)
Das tönt (wie vieles in dem Buch) etwas gestelzt, meint aber das Richtige. Dass das Programm bei Kulturschaffenden auf derart heftige emotionale Ablehnung stösst, dürfte nicht zuletzt an einer zweiten Diagnose liegen. Was man in der Schweiz schon in der Debatte um die Buchpreisbindung beobachten konnte, wird hier noch deutlicher: Solche Ideen stellen die gesellschaftliche und politische Deutungshoheit Kulturschaffender und damit ihre sozusagen seherische Sonderstellung in der Gesellschaft in Frage. Eine narzisstische Kränkung beflügelt das Ressentiment der empörten Kritiker der Buchthesen.
Ginge es um Gesundheitswesen, ökonomische Theorien oder Landesverteidigung würde ein vergleichbares Buch bloss Anlass zur fruchtbaren Analyse der Argumente geben. Nicht so in der Kulturbranche. Allein, dass es sichtbar macht, wie unreif die Debatte hier geführt wird, rechtfertigt sein Erscheinen.
Das Gedankenexperiment, auf das der «Spiegel»-Artikel die differenzierte Argumentation im Buch bereits im Titel («Die Hälfte?») eindampft, wird zum Mittel der Dämonisierung der Autoren. Es ist zu hoffen, dass auch tatsächlich eine konstruktivere Diskussion geführt wird, ist das Buch einmal ganz gelesen worden. Es wäre schade, würden die Verfasser nur Opfer ihrer waghalsigen, aber offenbar überaus erfolgreichen Strategie des Weckens von Aufmerksamkeit.
Autoritäre und vordemokratische Strukturen
Bereits die zwei wichtigsten historischen Erklärungen zum Zustand des gegenwärtigen Kulturleben treffen einen empfindlich wunden Punkt: Sein Programm sei die «ästhetische Erziehung des Menschengeschlechts», und als solches autoritär, aristokratisch und vordemokratisch (24). Zudem habe sich ein klaffender Widerspruch seit seiner Einführung durch die Kritische Theorie nie auflösen lassen: Dass einerseits «Kultur für alle» gefordert werde, aber andererseits alles unter Generalverdacht stehe, was populären Anstrich habe («Kunst, die sich am Markt behaupten muss, bedient den Geschmack der Massen. Deshalb kann sie nicht frei sein. Und der Massengeschmack ist einförmig und redundant» 69).
Darin zeige sich das wahre Menschenbild der gegenwärtigen Kulturwirtschaft: Die Gesellschaft besteht angeblich aus gebildeten Eliten, der bildungsferne Durchschnittsbürger habe demgegenüber eine mangelhafte emotionale und soziale Ausstattung und begnüge sich mit dumben Vergnügungen à la Musikantenstadl und Fantasyfilmen. Der «empfindsame Bürger ist dem ekstatischen Pöbel überlegen» (37).
Kaum zu wiederlegen ist eines der stärksten Argumente des Textes. Es attestiert ein Scheitern des bisherigen Paradigmas: Zwar ist das kulturelle Angebot massiv vergrössert worden (16f), die Zahl der Nutzer ist aber gleich geblieben oder sogar eher zurückgegangen. Statt Kultur für alle gibt’s heute ein Überangebot für die, die schon immer Kultur konsumiert hatten. Dass da ein eklatanter und zutiefst undemokratischer Systemfehler vorliegt, über den unbedingt nachgedacht werden muss, ist offensichtlich.
Die Autoren tun es aus einer etwas verengten ökonomischen Perspektive heraus. Das ist legitim. Sie haben als Kulturfunktionäre und Manager ihre spezielle Sicht auf die Dinge. So fehlen etwa differenzierte Überlegungen dazu, wie man publikumsferne, aber ästhetisch relevante Entwicklungen ermöglichen kann. Gedanken zum Forschungsaspekt der Kunst verengen sie auf bissige Bemerkungen zu modischen «Kunst ist Forschung»-Slogans (275).
Dem könnte man entgegenhalten, dass es spezifische ästhetische Forschungsfelder gibt, die immer wieder bedeutende Systeme erzeugt haben wie die Dur/Moll-Tonalität, die Perspektive, den Farbenkreis, Erzähltheorien oder Strategien zur luziden und eleganten Darstellung von Ideen. Forschung ist nicht reduzierbar auf naturwissenschaftliches Experimentieren und mathematische Formeln.
Allerdings liegt auch in dieser Hinsicht heute einiges im Argen. Es fehlt landauf, landab die Kompetenz, um relevante ästhetische Entdeckungen als solche zu identifizieren oder auch nur zu erahnen. Am ehsten ist dies noch der Fall in den stürmischen Entwicklungen der Film- und Digitaltechnik, in Bezug auf neue Medien also, die erst mal von Grund auf erforscht werden müssen.
Wie weit entfernt sich die Kunstproduktion von einem Renaissance-Ideal der Einheit der Erkenntnis entfernt hat, zeigt möglicherweise die Tendenz, Künstlerkommunen in Industriebrachen anzusiedeln (142). Die «Kulturinfarkt»-Autoren sehen darin eine Zelebrieren der Befreiung von Arbeit Man kann es auch als Kompensation dafür betrachten, dass der Kunst der nüchtern-rationale, technisch-handwerkliche und realitätsbezogene Blick auf die Welt abhanden gekommen ist und die Industriehalle zum dekorativen Behaupten der Ganzheitlichkeit herhalten muss.
Ein zeitgemässes Gesellschaftsbild
«Der Kulturinfarkt» stellt auch die unter Kulturschaffenden tabuisierte Frage, wie weit staatliche Kulturförderung auch schaden kann und weisen richtigerweise darauf hin, dass sie möglicherweise sinnvollere Angebote «im Markt erschwert, verdrängt oder gar verhindert» (194). Sie plädieren dafür, dass der Staat, «statt Auserwählte zu fördern, Möglichkeiten schafft, in denen sich alle realisieren können» (186). Der Staat soll kein Werturteil fällen, sondern Freiräume schaffen. Er soll sich nicht über Künstler oder Kunstströmungen definieren, sondern Infrastrukturen unterhalten.
Wie treffend manche Einzelanalyse des Buches ist, verbirgt sich hinter streckenweise allzu sorglos polemisch, pauschal und unpräzise verdichteter Rhetorik, die selber stark an die von den Autoren demaskierten Texte der Kritischen Theorie erinnert. Das riecht ein wenig nach Selbstbefreiung aus der Hybris der Frankfurter Schule.
Die stärksten und politisch erfrischendsten Passagen hat das Buch in der Darlegung eines zeitgemässen Menschenbildes (178f), das davon ausgeht, dass Bürger mündig sind, mit den finanziellen Ressourcen des Staates vernünftig umgehen, wenn sie dazu (wie in der Schweiz) auch etwas zu sagen haben. Befreiend ist aber eben auch die Verabschiedung des verheerenden und misanthropischen Klischees der Kritischen Theorie, dass der kunstferne, einfache Bürger nur zu oberflächlichen emotionalen Erlebnissen fähig ist und der moralischen Anleitung des gebildeten Elitebürgers bedarf um nicht im Massenmarkt dem geistigen Tod anheimzufallen.
Das Buch demaskiert die Geschmacksverfeinerung des Kunstbürgers als eigentlich weltfremde, ja arrogante Attitüde. Eine Kunst, die regelmässig Anschluss an die emotionalen Bedürfnisse des Durchschnittsbürger findet, würde demgegenüber Wirklichkeitsbezug haben. «Sie würde mehr am Menschen Mass nehmen und weniger am Konzept» (183).
Auch die aus einer so radikal demokratischen Sicht der Kulturbedürfnisse resultierenden Vorschläge zur Neuorganisation der Kulturförderung sind schlüssig: Bestehen könnte sie etwa aus einem Kulturrat, der «kein Expertengremium von Kulturprofis ist», aus der «Schlüsselrolle einiger Individuen, hier Intendanten genannt» und drittens einer zeitlichen Ämterbegrenzung, die zyklische Erneuerung erzwingt (230). Dazu sollen Fördermodelle kommen, die «mehrjährigen (finanziellen) Raum für Aufbauarbeit schaffen» und per Los vergeben werden sollen (231). Das sind Konzeptionen, die wohl kaum eins zu eins implementiert werden können, aber für künftige Diskussionen die richtigen Anregungen geben. (wb)
Dieter Haselbach, Armin Klein, Pius Knüsel, Stephan Opitz: Der Kulturinfarkt. Von allem zu viel und überall das Gleiche. Eine Polemik über Kulturpolitik, Kulturstaat, Kultursubvention. Knaus-Verlag, München 2012, 298 S., Fr. 28.50
© www.codexflores.ch
Ähnliche News
-
15. April 2024
Treffen mit Antje Valentin beim DMR -
20. Dezember 2023
Kulturpolitisches Positionspapier 2023 -
21. Oktober 2023
Kulturhaushalt: Appell der Koalition der Freien Szene -
11. September 2023
Abgeordnetenhaus berät über Kulturhaushalt -
19. November 2022
Gespräch mit dem Kulturstaatssekretär -
20. September 2022
Gespräche mit ver.di und dem Landesmusikrat Berlin -
24. Juli 2022
Allianz der Freien Künste positioniert sich zu Honoraruntergrenzen