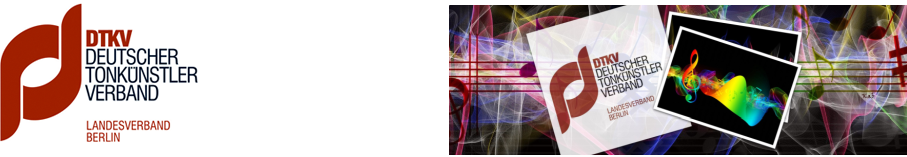News
30. Mai 2016
Infobrief für freie Musiker(innen) und Musikpädagog(inn)en in Berlin
Ein Appell für berufsständisches Engagement von Helge Harding und Wendelin Bitzan
Die vollständige Fassung finden Sie weiter unten auf der Seite.
Als PDF zum Download gibt es
- hier den Teaser
- hier die vollständige Fassung
Teaser
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Bedingungen für das freiberufliche Musikertum in der Kulturstadt Berlin sind besorgniserregend. Konkurrenzdruck und Existenzangst, gepaart mit künstlerischem Idealismus, veranlassen viele von uns dazu, zu ungünstigen oder gar prekären Konditionen zu arbeiten. Der Arbeitsmarkt ist äußerst angespannt und Patchwork-Existenzen sind weit verbreitet. Angesichts ernüchternder Perspektiven breiten sich vielerorts Unmut und Frustration aus. Die Hintergründe der Situation sind allerdings komplex. Warum sie so ist und wie es dazu gekommen ist, wissen die meisten von uns nicht. Ein Verständnis für diese Zusammenhänge ist aber von zentraler Bedeutung, wenn wir Verbesserungen erreichen wollen. Einseitige und vorschnelle Schuldzuweisungen aus Unwissenheit sind nicht konstruktiv.
Die Ursachen für die vielen Missstände und Schwierigkeiten unserer Branche liegen gleichermaßen in politischen wie in berufsständischen Verwaltungs- und Organisationsstrukturen. Mindestens für die berufsständischen Verhältnisse tragen wir selbst Verantwortung. Dazu gehören trotz dem bereits von vielen Seiten geleisteten hohen Engagement leider auch Versäumnisse. Kulturpolitik und Administrationen agieren in gesetzlich vorgegebenen Handlungsrahmen, innerhalb derer Veränderungen in aller Regel nicht einfach zu erreichen sind. Diese Strukturen und Zusammenhänge stellen wir in unserem Infobrief ausführlich dar. Den einen oder die andere mögen die gewonnenen Erkenntnisse vielleicht überraschen.
Unser wichtigstes Anliegen ist, das allgemeine Engagement sowie den Vernetzungs- und Organisationsgrad innerhalb unserer Kollegenschaft signifikant zu erhöhen. Wir können nur gemeinsam, mit gebündeltem Engagement, überfällige Verbesserungen unserer Situation erwirken. Aus unserer Sicht ist daher die Entwicklung eines berufsständischen Ethos, das uns selbstbewusst und vorausschauend gegenüber Vertragspartnern und Entscheidungsträgern agieren lässt, unbedingt erforderlich. Unsere berufsständische Vertretung muss professionalisiert werden, wenn wir die Fortschritte erreichen wollen, die wir uns wünschen. Angesichts unserer sehr begrenzten Ressourcen überwiegen zur Zeit noch ehrenamtliche Strukturen. Auch deswegen sollten unnötige Konflikte vermieden werden – vor allem mit der vermeintlichen Gegenseite in Politik und Verwaltung, aber auch untereinander. Unsere Kommunikationshaltung sollte selbstbewusst und vor allem sachlich sein. So können wir die gesellschaftliche Relevanz unserer Arbeit angemessen darstellen und für die besonderen Bedingungen werben, die wir uns für eine angemessenere und damit befriedigendere Berufsausübung vorstellen.
Als mittel- und langfristige strukturelle Maßnahmen wäre die Bündelung unserer Aktivitäten in einem Landeskulturrat, der als Dachverband der Berliner Kulturorganisationen und Verbände wirken könnte, sowie die Gründung einer Kammer für Musik denkbar. Eine solche finanziell und personell gut ausgestattete berufsständische Körperschaft könnte die Interessen unserer Branche besser als bisher koordinieren. Sie könnte außerdem stabile und professionelle Organisationsstrukturen für die Belange der Musikausübung und musikalischen Ausbildung bereitstellen – beispielsweise durch geschützte Berufsbezeichnungen oder die Verabschiedung einer verbindlichen Gebührenordnung für musikalische und pädagogische Dienstleistungen.
Wir laden Euch herzlich ein, die vollständige Fassung unseres Infobriefs zu lesen.
Gern könnt Ihr uns nach der Lektüre auch persönlich kontaktieren, wenn Ihr Fragen habt. Jede und jeder Einzelne ist gefragt und gefordert, sich im Rahmen ihrer/seiner Möglichkeiten zu engagieren.
Helge Harding (hh@helge-harding.com)
Wendelin Bitzan (wen.de.lin@web.de)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vollständige Fassung
Helge Harding | Wendelin Bitzan
Infobrief für freie Musiker(innen) und Musikpädagog(inn)en in Berlin
Ein Appell für berufsständisches Engagement
In der Kulturstadt Berlin herrschen besorgniserregende Bedingungen für das freiberufliche Musikertum. Der Arbeitsmarkt im professionellen Musikbetrieb ist äußerst angespannt: Stellen in Orchestern und Chören sind umkämpft und in Zahlen rückläufig, an den öffentlichen Musikschulen sind weniger als 10% der Mitarbeiter fest angestellt; in institutionellem Rahmen gibt es praktisch keine Entwicklung, Perspektiven und Dynamik. Die Musikhochschulen bilden am Bedarf vorbei aus, viele Absolventen werden nicht adäquat auf das Berufsleben vorbereitet und stehen nach ihrem Hochschulabschluss vor einer höchst ungewissen Laufbahn. Existenzgrundlage der meisten Kolleginnen und Kollegen ist eine patchwork-artige Mischung aus kargen Gagen und freiberuflichen Unterrichtshonoraren – das Berufsbild Musikerin/Musiker bzw. Musikpädagogin/Musikpädagoge ist ein prekäres. Gerade die Situation für Freiberufler ist, trotz außergewöhnlicher Angebote und Möglichkeiten in der Stadt, schwerer denn je – ein fataler Unterbietungswettbewerb bei den Honoraren hat oftmals Einkünfte am Existenzminimum zur Folge.
Vor diesem Hintergrund sind Unmut, Frustration und ein Gefühl der Machtlosigkeit mehr als verständlich. Dennoch sind wir der Situation nicht hilflos ausgeliefert: Wir können uns dafür engagieren, dass sich die Zustände verbessern. Eine wichtige Rolle spielt dabei die geschickte Bündelung unserer berufsständischen Kräfte. Dieses Schreiben versucht die aktuelle Situation differenziert und unter Berücksichtigung der Standpunkte der verschiedenen beteiligten Parteien darzustellen. Es möchte Denkanstöße liefern und den Vernetzungsgrad innerhalb unserer Kollegenschaft erhöhen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
viele von uns sind unzufrieden mit ihrer Situation als freiberufliche Musikerinnen und Musiker bzw. Musikpägagoginnen und Musikpädagogen in Berlin – und dies zu Recht, denn es ist schwieriger denn je, mit der Musik seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Die oftmals schlecht bis überhaupt nicht geregelten Arbeitsbedingungen, die gemessen an der Qualifikation sehr kargen Vergütungen und nicht zuletzt ernüchternde Zukunftsperspektiven sind aus berufsständischer Sicht inakzeptabel. Dies betrifft insbesondere diejenigen von uns, die an Musikschulen und an Hochschulen unterrichten, aber auch die vielen freiberuflich musikalisch oder wissenschaftlich Tätigen. Es ist nachvollziehbar, dass sich vielerorts Unmut und Verdrossenheit ausbreiten.
Ein großer Teil unserer Kollegenschaft ist davon überzeugt, dass die Ursachen für die Missstände vorrangig administrativer Natur sind, dass die Berliner Kultur- und Bildungspolitik direkte Verantwortung trägt, und dass politische Änderungen nötig seien, um die Situation zu verbessern. Das sehen wir auch so. Allerdings bewegen sich auch die politischen und administrativen Akteure nicht im luftleeren Raum, sondern sind an bestimmte Handlungsrahmen gebunden, die sich aus ihrer jeweiligen Rolle sowie aus gesetzlichen Bestimmungen ergeben. Die Zusammenhänge sind komplex und von unseren künstlerischen oder wissenschaftlichen Realitäten weit entfernt. Deshalb lohnt ein genauerer Blick: Die genannten Zusammenhänge und Strukturen bestimmen unser berufliches Umfeld auf maßgebliche Weise. Ein Verständnis der betreffenden Abläufe ist aus unserer Sicht Voraussetzung, um zwischen individuellen und strukturellen Aspekten differenzieren zu können.
Genauso maßgeblich ist aber der Umstand, dass wir, gemessen an derzeitigen und zukünftigen Herausforderungen, berufsständisch bisher zu schlecht organisiert sind – trotz des von vielen Kolleginnen und Kollegen bereits geleisteten Engagements. Um nicht nur auf gesellschaftliche und administrative Veränderungen zu reagieren, sondern auch zukünftige Entwickungen in unserem Sinne aktiv mitgestalten zu können, müssten bestehende Verbandsstrukturen dynamisiert, modernisiert und besser untereinander koordiniert werden. Da wir als Berufsgruppe schwach sind und praktisch keine Druckmittel haben, sind wir auf Kooperationen angewiesen. Gesamtgesellschaftlich betrachtet sind wir eine relativ kleine Interessengemeinschaft; Politik orientiert sich aber an Mehrheiten. Diesem Informationsschreiben möchte einen Anstoß geben, unsere Berufsgruppe in ihrer Gesamtheit stärker und entschlossener als bisher zu aktivieren. Änderungen und Verbesserungen bewirken wir nur, wenn wir unseren Organisationsgrad signifikant erhöhen und uns stärker als bisher engagieren, vernetzen und austauschen – nur gemeinsam können wir für unsere Interessen eintreten.
I. Beobachtungen zur aktuellen Situation
Es reicht nicht aus, sich nur zu beschweren und Missstände anzuprangern. Eigenes Engagement ist gefragt. Dabei ist eine sachliche Kommunikationsebene entscheidend. Wenn zu emotional argumentiert wird oder gar Feindbilder entwickelt und gepflegt werden (»die Senatsverwaltung ist an allem schuld«), verhindert dies den kooperativen Austausch, den wir anstreben und der aus unserer Sicht nötig ist, damit sich Dinge zum Besseren wenden können. Eine vorwurfsvolle Haltung führt in der Regel zu tauben Ohren auf Seiten der politischen und administrativen Akteure; dies können wir uns aber nicht länger leisten.
Die Gesellschaft verändert sich. Wir stehen in wachsender Konkurrenz zu anderen gesellschaftlich relevanten Bildungs- und Kulturangeboten. Auch deshalb wird es immer wichtiger, die besondere Bedeutung unserer Arbeit zu erläutern und gegenüber der Politik und der Allgemeinheit darzustellen. Die zentrale Frage lautet dabei stets: Was hat die Gesellschaft davon, wenn sie mehr Steuergelder in Musik und musikalische Bildung steckt? Diese Gelder müssen vor verschiedenen Gremien gerechtfertigt werden; um sie bemühen sich aber auch andere Berufs- und Interessengruppen. Gute und sachliche Argumente, die auch Menschen einleuchten, die noch nie mit ›klassischer‹ Musik in Berührung gekommen sind, sind also sehr in unserem Interesse. Es ist schwierig, dies entsprechend zu formulieren und zu belegen – und doch werden wir uns diese Mühe machen müssen, wenn wir Verbesserungen erreichen wollen.
Positiv ist immerhin, dass es für den Musikbereich vergleichsweise viele Organisationen und Verbände gibt. Gleichzeitig ist dies auch ein Problem, weil die Vernetzung der einzelnen Organe zu wünschen übrig lässt. Ein Grund dafür ist, dass unsere Berufsverbände und Gewerkschaften bisher überwiegend ehrenamtlich arbeiten, also auf die aktive Zuarbeit ihrer Mitglieder angewiesen sind. Professionelle, also spezialisierte und marktüblich entlohnte Verwaltungskräfte können sich die Verbände bisher (bis auf einige wenige Ausnahmen) nicht leisten, obwohl wir solche dringend bräuchten, um die anstehenden Herausforderungen angemessen zu bewältigen und zukunftsfähig planen zu können.
Neben der Tatsache, dass die maßgeblichen Akteure in den Bezirken und auf Landesebene eher aneinander vorbei als miteinander zusammen arbeiten, ist auch die Vernetzung von Schulen, Musikschulen und Hochschulen bisher unzureichend und sollte verbessert werden. Etwa findet derzeit keine zukunftsfähige und realistische Planung hinsichtlich der Frage statt, wie eine zeitgemäße Musik- und Musiklehrerausbildung in Berlin aussehen könnte. Wichtige, die Zukunft betreffende Fragen (etwa: Wie sieht der Berliner Musikmarkt in 10 oder 20 Jahren aus, wenn wir so weitermachen wie bisher? Was wollen wir gegenüber der derzeitigen Situation verändern?) werden praktisch nicht diskutiert. Dies liegt nicht etwa an mangelndem Engagement der handelnden Personen innerhalb der bestehenden Strukturen – dies ist in der Regel sogar überdurchschnittlich hoch. Aus unserer Sicht liegt es vor allem daran, dass bisher kein Gremium existiert, das die Bemühungen und Initiativen auf effektive Weise bündeln könnte.
Ein konkretes Beispiel soll die seit langem angespannte und unbefriedigende Situation veranschaulichen: An den öffentlichen Berliner Musikschulen haben sich in jüngerer Zeit besonders an zwei Ereignissen die Gemüter entzündet. Dies sind die neuen, im Jahr 2013 in Kraft getretenen Ausführungsvorschriften zur Honorarzahlung sowie die etwa zeitgleich eingeführte Verwaltungssoftware »MS-IT«. Die in diesem Zusammenhang kumulierte Frustration aller Beteiligten sehen wir als Resultat von berufsständischen, administrativen und strukturellen Versäumnissen in der Vergangenheit, für die es keine einfachen Lösungen gibt. Wir beobachten auf Seiten der Musikschulen einseitige Schuldzuweisungen (»die Politik ist schuld«), die jedoch vielfach aus Unkenntnis der komplexen Hintergründe geschehen und überdies keine eigene Veränderungsbereitschaft erkennen lassen. Demgegenüber scheint man sich auf politischer Ebene von uns eine Form der Beratung zu wünschen, die wir mit unseren ehrenamtlichen Strukturen bisher schlicht nicht bieten konnten. Beide Haltungen, so verständlich sie sein mögen, sind letztlich nicht produktiv, erschweren uns allen die Arbeit und stehen zeitgemäßen und zukunftsorientierten Lösungen im Weg.
Das gemeinsame Problem aller Akteure sind also strukturelle Gegebenheiten, von denen einige spezifisch für Berlin sind. Wir finden es wichtig, dass innerhalb unser Kollegenschaft ein Verständnis für diese Strukturen und Prozesse entsteht. Dadurch kann das Konfliktpotential mit der vermeintlichen Gegenseite verringert und ein konstruktiverer Austausch ermöglicht werden.
II. Politisches, Strukturelles, Grundsätzliches
In diesem Abschnitt sollen die politischen Organisationseinheiten in Berlin überblicksartig dargestellt und ihre Bedeutung und Verantwortung für die Administration der kulturellen Institutionen der Stadt benannt werden. Wir beschränken unsere Betrachtungen auf drei Bereiche: a) die öffentlichen und privaten Musikschulen sowie private Angebote für Musikunterricht, b) die Musikhochschulen, c) den freiberuflichen Markt für Musik, also Konzerte und andere musikalische Veranstaltungen. (Dem gesellschaftlich überaus wichtigen Bereich der Musik an allgemeinbildenden Schulen widmen wir uns lediglich am Rande – zum Einen deshalb, weil Schulmusikerinnen und Schulmusiker überwiegend in gesicherten Arbeitsverhältnissen arbeiten, zum Anderen, weil diese Berufsgruppe bereits vergleichsweise gut organisiert ist. Nichtsdestotrotz raten wir auch zu einem verstärkten Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen sowie den Verbänden der Schulmusik.)
Die Berliner Landesregierung, der Senat, besteht aus dem Regierenden Bürgermeister sowie den derzeit acht Senator_innen und ihren jeweiligen Senatsverwaltungen. In der ablaufenden Legislaturperiode leitet Senatorin Sandra Scheeres die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft. Für diese drei Ressorts gibt es jeweils einen Staatssekretär. Der derzeitige Staatssekretär für das Ressort Bildung ist Mark Rackles. In seiner Zuständigkeit liegt ein Referat (eine Fachabteilung) für »Erwachsenen- und Grundbildung, Lebenslanges Lernen und außerschulische Bildung«, das für die öffentlichen Musikschulen und Volkshochschulen zuständig ist. Der Staatssekretär für das Ressort Wissenschaft, Steffen Krach, verwaltet ein Referat für »Universitäten, Hochschulen, Kunsthochschulen und private Hochschulen«. Demgegenüber werden der Musikbereich, also Konzerte und andere Veranstaltungen, sowie die Angelegenheiten der privaten Musikschulen von einer anderen Verwaltungseinheit abgedeckt, nämlich der Senatskanzlei für kulturelle Angelegenheiten. Sie wird von Staatssekretär Tim Renner geleitet und zählt zum Ressort des Regierenden Bürgermeisters, Michael Müller, der auch amtierender Kultursenator ist. Diese Trennung der Zuständigkeiten ist lange gewachsen, ist allerdings aus berufsständischer Sicht nicht unbedingt hilfreich.
Das Berliner Landesparlament ist das Abgeordnetenhaus. Es erarbeitet in seinen Ausschüssen Gesetzes-vorlagen, die vom Parlament verabschiedet und dann von den Senatsverwaltungen umgesetzt werden. Diese erlassen dazu dann sogenannte Ausführungsvorschriften (die jüngsten Ausführungsvorschriften für die Honorarzahlung an den öffentlichen Musikschulen sind ein Beispiel dafür). Umgekehrt kann der Senat bei der Haushaltsplanung an das Abgeordnetenhaus herantreten und Mittelzuweisungen beantragen, worüber dann die Abgeordneten bzw. die Ausschüsse (hier vor allem der Hauptausschuss) beraten, und zuletzt wieder das Parlament abstimmt. Die Abgeordneten können sogenannte ›große‹ und ›kleine Anfragen‹ stellen, zu denen die Senatsverwaltung antworten und Stellung nehmen muss. Auf diese Weise können detaillierte Auskünfte eingeholt werden, die normalerweise nicht an die Öffentlichkeit gelangen.
Berlin besitzt eine zweistufige Verwaltung. Das Bundesland ist in zwölf selbstverwaltete Bezirke unterteilt, die sozusagen die kommunale Ebene bilden. Jeder Bezirk ist formal gegenüber dem Land Berlin eigenständig und verfügt über eine eigene Bezirksverwaltung, Bezirksverordnetenversammlung und einen eigenen Haushalt. De facto sind die Bezirke aber vor allem hinsichtlich der Mittelzuweisungen vollständig von der Landesebene abhängig, und die tatsächlichen Handlungsspielräume sind äußerst gering. Die Mittelzuweisung wird nach bestimmten, sehr komplizierten Verteilungsschlüsseln vorgenommen und erfolgt im Rahmen sogenannter ›Doppelhaushalte‹ immer für zwei Jahre. Da das Land aber seit Jahren sparen muss und die Bezirke natürlich an diesem Vorgang beteiligt werden, sind die ihnen zugewiesenen Mittel eigentlich niemals für alle von ihnen wahrgenommenen Aufgaben ausreichend. Die Bezirke müssen dann zunächst ihren Pflichtaufgaben nachkommen. Das kulturelle Angebot, aber auch die Musikschulen als Einrichtung der außerschulischen Bildung, zählen jedoch zu den sogenannten ›freiwilligen Leistungen‹. Ob und wie eine öffentliche Musikschule finanziert wird, liegt also letztlich im Ermessen des jeweiligen Bezirkes. Eine langfristige Planungssicherheit für kulturelle Arbeit oder den Betrieb einer Musikschule ist so praktisch nicht gegeben.
a) Öffentliche und private Musikschulen und privater MusikunterrichtDie öffentlichen Musikschulen sind verwaltungsrechtlich den Bezirksämtern zugeordnet. Dienstherrin der Musikschulleitungen ist aber dennoch das Land Berlin, das unter anderem landesweite Dienstbesprechungen mit den Musikschulleitungen durchführt. Die fest angestellten Mitarbeiter (derzeit nur etwa 9%; hauptsächlich Leitungsstellen) werden nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) bezahlt, der in wesentlichen Teilen bundesweit gilt. Die Honorare der freien Mitarbeiter werden, am TVöD orientiert, zwischen der Senatsverwaltung für Finanzen und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft ausgehandelt und sind für die Bezirke bindend.
Die betriebswirtschaftlich inspirierte Kosten-Leistungs-Rechnung (KLR), nach der die Bezirke wirtschaften müssen, führt zu einem Spar-Wettbewerb der Bezirke untereinander. Vereinfacht gesagt wird angestrebt, möglichst billige ›Produkte‹ anzubieten; im konkreten Fall der Musikschule ist beispielsweise der instrumentale Einzelunterricht ein solches Produkt. Qualität spielt dabei keine Rolle, was aus berufsständischer Sicht besonders problematisch ist. Wenn eine Musikschule etwa ein eigenes Gebäude unterhält (was natürlich eigentlich unerlässlich ist und der Qualität der Dienstleistung zu Gute kommt, beispielsweise durch den kollegialen Austausch vor Ort), wird das ›Produkt‹ hierdurch verteuert. Als Resultat geraten die verantwortliche Musikschulleitung und damit auch der Bezirk, der diese Musikschule unterhält, unter Rechtfertigungsdruck gegenüber anderen Musikschulen und Bezirken, die ihren Unterricht möglicherweise deutlich billiger anbieten, wenn dieser etwa überwiegend in allgemeinbildenden Schulen stattfindet. Die KLR setzt also einen Bieterwettbewerb nach unten in Gang, was katastrophale Auswirkungen für unsere Arbeit hat – viele von uns können davon ein Lied singen. Das bestehende System mit zwölf separaten Bezirksmusikschulen dient also, vorsichtig formuliert, nicht unbedingt unseren Interessen.
Ein weiteres Beispiel: Wenn eine Musikschule nun besonders gut gewirtschaftet und Überschüsse erzielt hat, profitiert sie zunächst nicht davon. Die eingesparten Mittel fließen erst einmal zurück in die Etats der Bezirke, die dann entscheiden können, ob und wieviel sie der Musikschule im nächsten Haushalt, also zwei Jahre später, wieder zur Verfügung stellen. Für die Musikschulen besteht also keine direkte Möglichkeit, erwirtschaftetes Geld wieder verwenden zu können. Auf diese Weise wird es deutlich erschwert, eigene, nach außen wahrnehmbare Akzente zu setzen oder zukunftsorientierte Angebote zu entwickeln.
Private Musikschulen können unabhängiger wirtschaften, müssen in der Regel aber eine Immobilie finanzieren, um ihr Angebot aufrecht erhalten zu können. Im Gegensatz zu den öffentlichen Institutionen bekommen sie dafür keinerlei Subventionen vom Land Berlin. Typischerweise refinanzieren private Musikschulen ihre Mehrkosten über höhere Unterrichtsgebühren und geringere Sozialermäßigungen. Das größte Einsparungspotential liegt aber im Bereich der Personalkosten: private Musikschulen finanzieren sich maßgeblich über die signifikant niedrigeren Lehrerhonorare. Die aus unserer Sicht schon deutlich zu niedrigen Honorare öffentlicher Musikschulen werden auf diese Weise noch einmal unterboten – und dies, obwohl private Musikschulen im Wesentlichen identische Leistungen anbieten wie öffentliche Musikschulen, teilweise sogar mit denselben Lehrkräften, also auf gleichem Qualifikationsniveau.
Diese Lage ist auch für privat erteilten Musikunterricht außerhalb der Organisationsform einer Musikschule problematisch. Freiberufliche Musikpädagoginnen und Musikpädagogen haben eine Kostenstruktur, die weder mit öffentlichen noch mit privaten Musikschulen vergleichbar ist, sondern eher mit freien Unternehmen bzw. Solo-Selbstständigen (Ich-AG). Typischerweise unterrichten freie Musiklehrkräfte in ihren Privaträumen und müssen nur zum Teil für Raummieten aufkommen. Dafür entstehen aber eigentlich immer Auslagen für folgende Posten: Anschaffung und Instandhaltung von Instrumenten, Anschaffung von Noten und anderen Unterrichtsmaterialien, Weiterbildungen, Versicherungen, Telefon, Computer, Rücklagen, Steuern usw. Faktisch müssten fast alle selbständigen Musikpädagoginnen und Musikpädagogen auf diese Weise kalkulieren, selbst wenn sie außerdem ›freiberuflich‹ für öffentliche oder private Musikschulen tätig sind. Allerdings lassen sich auf diese Weise errechnete Honorarsätze auf dem freien Markt kaum durchsetzen. Das hat zum einen mit der beschriebenen Konkurrenzsituation zu den Musikschulen zu tun, zum anderen aber auch mit dem sozialen Ethos vieler Kolleginnen und Kollegen, die finanziell weniger gut gestellten Menschen entgegenkommen möchten. So begrüßenswert dies im Prinzip ist – das berufsständisch-betriebswirtschaftliche Interesse sollte nicht mit individueller Solidarität und Hilfsbereitschaft konkurrieren müssen.
Hierzu ein kleiner juristischer Exkurs: Die als solche bezeichnete ›freiberufliche Tätigkeit‹ für öffentliche oder private Musikschulen erfüllt nach Prüfungen der Deutschen Rentenversicherung in vielen Fällen die arbeitsrechtlichen und sozialrechtlichen Kriterien für eine Scheinselbstständigkeit. Abgesehen davon, dass es absurd ist, eine ganze Institution, deren Arbeit auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit angelegt ist, fast vollständig mit freien Mitarbeitern zu betreiben, ist dies eine skandalöse Entwicklung. Öffentliche Arbeitgeber schädigen auf diese Weise die Gemeinschaft der Sozialversicherung und tragen so absehbar zu Altersarmut bei. Erstaunlicherweise hat die Rentenversicherung ihre Sichtweise geändert, nachdem die jüngsten Ausführungsvorschriften für die öffentlichen Musikschulen mit ihr abgestimmt wurden, und beanstandet seitdem keine Scheinselbständigkeit mehr. Wir stimmen dieser Einschätzung jedoch nicht zu, da sich an den Tatsachen faktisch nichts geändert hat. Bisherige Bemühungen, die verbreitete Scheinselbständigkeit vor Gericht bestätigen zu lassen, waren erfolglos, was aber auch an der juristischen Vertretung und der unkoordinierten Art und Weise gelegen hat, wie die Klagen geführt worden sind.
Aber zurück zum Finanziellen: Selbst dann, wenn flächendeckend auf die oben beschriebene Weise betriebswirtschaftlich gerechnet würde, gäbe es noch keine Möglichkeit, durch individuelle Honorarsätze unterschiedliche Qualifikationsniveaus abzubilden. Hierzu bedürfte es einer gesonderten Berechnung auf Grundlage eines mindestens landesweiten Vergleichs sowie einer Richtlinie für qualifikationsabhängige Entgelte für Musikunterricht. Eine solche Richtlinie existiert bisher nicht. Es gibt zwar Gagenempfehlungen für freie Musikerinnen und Musiker, nicht aber für musikpädagogische Angebote. Empfehlungen sind zudem zwar besser als nichts, bleiben letztlich aber unverbindlich, weil sie rechtlich nicht durchsetzbar sind. Anders wäre dies beim Vorliegen einer Gebührenordnung, wie sie etwa für medizinische Dienstleistungen existiert– die entsprechenden Vorgaben sind justitiabel, also im Zweifel auch einklagbar. Auch wenn es zweifellos ein weiter Weg ist, wäre es aus unserer Sicht ein lohnendes Ziel, eine Gebührenordnung für Musik und Musikunterricht zu entwickeln.
Wie man sich in diesem komplizierten strukturellen Gefüge verhält, ist letztlich natürlich eine individuelle Entscheidung. Aus berufsständischer Sicht wäre allerdings eine gesamtstädtische Strategie für musikalische Bildung wünschenswert, welche die maßgeblichen Inhalte und Ziele genauso klar definiert wie angemessene Arbeitsbedingungen für diejenigen, die diese Aufgaben ausführen sollen.
b) Musikhochschulen
Die beiden Musikhochschulen (Hochschule für Musik »Hanns Eisler« Berlin und die Fakultät Musik der Universität der Künste Berlin) fallen ebenfalls in den Zuständigkeitsbereich der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, sind aber direkt dem Land unterstellt. Durch die Hochschulrahmenverträge, welche die Mittelzuweisung regeln, besitzen sie eine gewisse Autonomie: Alle fünf Jahre werden Zielvereinbarungen für die Hochschulen erstellt, anhand derer die Gelder vergeben werden. Am Ende dieses Zeitraums müssen die Hochschulen einen Rechenschaftsbericht ablegen. Innerhalb der durch die Hochschulrahmenverträge gesetzten Grenzen können die Hochschulen jedoch im Rahmen der akademischen Selbstverwaltung selbständig Mittel umwidmen; die Senatsverwaltung hat damit nichts mehr zu tun.
Über Personalmittel können die Hochschulleitungen nur teilweise selbständig entscheiden. Die vom Berliner Senat verabschiedete Besoldungsordnung für die Vergütung von Professorinnen und Professoren (Beamte der Länder) und angestellten Mitarbeitern (nach TVöD) ist für die Hochschulen verbindlich, ebenso die Ausführungsvorschrift für die Vergütung von Lehrbeauftragten und freien Mitarbeitern (bisher nicht an Tarifverträgen orientiert). Bei den Lehrauftragsentgelten gibt es jedoch einen gewissen Spielraum: Ein Fachbereichs- oder Fakultätsrat kann über eine bessere Vergütung beraten und anschließend einen Antrag verabschieden, über den der Akademische Senat der Hochschule entscheiden muss. Ein solcher Beschluss muss allerdings noch mit der Senatsverwaltung abgestimmt werden. Wenn ein solcher Antrag aber Aussicht auf Erfolg haben soll, und zwar bereits innerhalb der Hochschulen, muss der Forderung nach höheren Honoraren auch der nötige Nachdruck verliehen werden. Ein höherer Organisationsgrad der Lehrbeauftragten ist dafür eine zwingende Voraussetzung. In jüngerer Vergangenheit wurden in Berlin zwar geringfügige Erhöhungen der Honorarsätze realisiert; diese waren durch ein Entgegenkommen der Hochschulleitungen möglich. Gleichzeitig wurde signalisiert, dass mit weiteren Erhöhungen vorerst nicht zu rechnen sei.
Signifikante und überfällige Verbesserungen sind aber derzeit auch deswegen nicht in Sicht, weil die Gruppe der Lehrbeauftragten nicht gut genug organisiert ist, um eine stabile Verhandlungsposition gegenüber den Hochschulleitungen zu erreichen. Deutschlandweit ist in den letzten Jahren allerdings Bewegung in dieses Thema gekommen, vor allem durch die Initiative der Bundeskonferenz der Lehrbeauftragten an Musikhochschulen (BKLM). Durch deren Engagement konnten in einzelnen Bundesländern zum Teil sogar deutliche – wenn auch noch keine strukturellen – Verbesserungen erzielt werden. Diese sind eindrucksvolle Beispiele dafür, dass sich langfristiges berufsständisches Engagement auch finanziell lohnt; die Unterstützung der BKLM sollten wir auch in Berlin besser nutzen.
Für Berlin gilt außerdem: Legt man die mittlere Stufe der Lehrbeauftragtenentgelte (Erfüllung von professoralen Tätigkeiten, also beispielsweise das Erteilen von instrumentalem Hauptfachunterricht) zu Grunde, so unterscheiden sich die Honorarsätze an Hochschulen und an öffentlichen Musikschulen nicht wesentlich. Auf der tiefsten Entgeltstufe ist der Verdienst an einer Hochschule sogar schlechter, auf der dritten (Honorarprofessur) ein wenig besser als an einer Musikschule. Dies ist vor allem deshalb absurd, weil von Hochschullehrkräften eine besondere Qualifikation gefordert wird, die in vielen Fällen den Anforderungen an eine Professur gleichkommt. Dieses Qualifikationsniveau wird aber weder angemessen vergütet, noch werden die Lehrbeauftragten durch reguläre Arbeitsverträge oder eine tragfähige Sozialversicherung vor der realen Gefahr geschützt, dass sie sich letztlich ihre eigene Konkurrenz auf dem freien Markt ausbilden.
Lehraufträge sind zudem noch nicht einmal Arbeitsverhältnisse im arbeitsrechtlichen Sinne, sondern einseitige Aufträge, die lediglich für die Dauer eines Semesters vergeben werden und ohne Begründung und Einhaltung einer Frist auch wieder entzogen werden können. Lehraufträge sind per Definition für eine nebenberufliche und kurzfristige Tätigkeit gedacht und dürfen einen bestimmten Tätigkeitsumfang (derzeit in Berlin: 8,5 Semesterwochenstunden) nicht überschreiten. Dies ist sinnvoll, um kurzfristig entstehende Bedarfe der Hochschulen flexibel abdecken zu können. Für Daueraufgaben wie etwa den auf die Dauer der Regelstudienzeit angelegten Hauptfachunterricht sind Lehraufträge weder konzipiert noch geeignet.
Auch der prekäre Arbeitsmarkt an den Hochschulen ist nicht aus dem Nichts entstanden, sondern über lange Jahre gewachsen. Ohne dass wir die genannten Probleme immer wieder sachlich benennen und uns die Mühe machen, realistische Lösungswege aufzuzeigen, werden sich auch in diesem Bereich unserer Branche keine Verbesserungen einstellen.
c) Freie Musikszene
Patchwork-Existenzen sind in Berlin mittlerweile weit verbreitet und stellen eher die Regel als die Ausnahme dar. Musikerinnen und Musiker sind immer häufiger sowohl als freiberufliche Pädagogen (in privaten Unterrichtsverhältnissen und / oder an Musikschulen und Hochschulen) als auch künstlerisch auf dem freien Musikmarkt tätig. Hinzu kommen nichtmusikalische Qualifikationen, die in vielen Fällen zusätzliche Einkommensmöglichkeiten schaffen.
Auch im freiberuflichen Konzertbetrieb ist prinzipiell eine selbstbewusste Haltung erforderlich, um angemessene Stundensätze auszuhandeln, mit denen man vorausschauend wirtschaften kann. Eine solche Haltung ist jedoch bisher kaum anzutreffen, was wenig verwunderlich ist: Verhandlungsspielräume beim Honorar sind in den meisten Fällen marginal; wo sie überhaupt möglich sind, agieren viele Kolleginnen und Kollegen zurückhaltend, in den meisten Fällen aus nackter Existenzangst und aus der Befürchtung heraus, bei ›unangemessenen‹ Forderungen von billigeren Kräften ersetzt werden zu können. Unserer Ansicht nach spielt auch die Vorstellung eine Rolle, dass es als ›unschicklich‹ empfunden wird, die persönlichen künstlerischen Ideale mit einer wirtschaftlichen Argumentation zu verbinden. Diese Bereiche werden oft als polar entgegengesetzt empfunden, besonders im Kulturbetrieb, in dem es ja tatsächlich in erster Linie um künstlerische Fragen gehen sollte. Die Konsequenzen einer solchen Denkweise sind allerdings nicht nur aus berufsständischer Perspektive fatal: Wenn man für eine angemessene Vorbereitung nicht genügend Zeit findet, weil man von einem schlecht bezahlten Engagement zum nächsten hetzt, kann künstlerische Qualität nicht auf Dauer gewährleistet werden. Im freiberuflichen Konzertbetrieb liegen die Stundensätze (sofern man denn den Mut hat, diese tatsächlich und realistisch zu berechnen) oft unter dem Mindestlohn. Dies ist ein veritabler Skandal, berücksichtigt man das Qualifikationsniveau, das nötig ist, um professionell musizieren zu können. Bei näherer Betrachtung ist die Vorstellung einer Polarität zwischen künstlerischem Handeln und Finanzkalkulation also ein zentrales Hindernis – zunächst einmal für eine erfüllende künstlerische Tätigkeit, aber auch für die Entwicklung eines angemessenen berufsständischen Ethos.
Ein solches ist aber unbedingt erforderlich, wenn wir nachhaltige Verbesserungen erwirken wollen. Gerade im künstlerischen Bereich brauchen wir veränderte kulturpolitische Rahmenbedingungen, die den sich verändernden gesellschaftlichen und berufsständischen Realitäten Rechnung tragen. Der Landesverband der freien darstellenden Künste (LAFT), die »Koalition der Freien Szene« und der »Rat für die Künste« haben es in den vergangenen Jahren verstanden, ein öffentliches Bewusstsein für die Aufgabenbereiche ihrer Mitglieder zu wecken und mit der ›City Tax‹ eine Geldquelle zu erschließen, die diese Veränderungen finanzierbar macht. Auch hier sind signifikante Erfolge fast ausschließlich durch ehrenamtliche Arbeit erzielt worden, und engagierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter sind herzlich willkommen.
III. Was können wir tun?
Inzwischen wird deutlich geworden sein, dass es genügend Gründe für Berliner Musikerinnen und Musiker bzw. Musikpädagoginnen und Musikpädagogen gibt, sich möglichst weitgreifend in Berufsverbänden, Gewerkschaften und sonstigen Zusammenschlüssen zu organisieren. Nur so kann sich mittel- und langfristig ein ›Standesbewusstsein‹ entwickeln, das nötig ist, um sich auf einem komplexen Arbeitsmarkt zu behaupten und zukünftigen Herausforderungen effektiver als bisher begegnen zu können. Unser Berufsstand sollte kollektiv im Sinne einer Professionalisierung seiner Mitglieder argumentieren. Von der weit verbreiteten Mischung aus Idealismus und Existenzangst, die uns veranlasst, freiwillig zu unattraktiven Bedingungen zu arbeiten, möglicherweise sogar mehr als vereinbart, geht ein fatales Signal aus. Auftraggebern und Kundschaft wird dadurch suggeriert, dass es »irgendwie schon läuft«, dass für Mehrarbeit kein höherer finanzieller Aufwand entsteht, und dass es genügend Kolleginnen und Kollegen gibt, die »ihr Hobby zum Beruf gemacht haben« und aus purem Idealismus bereit sind, zu schlechten Konditionen zu arbeiten.
Unsere Kommunikationshaltung gegenüber Vertragspartnern und Entscheidungsträgern sollte allerdings nicht von Kritik bestimmt sein. Stattdessen sollten wir sachlich und selbstbewusst für unsere Sache eintreten. Es geht um ein Werben für die eigenen Interessen, die Relevanz und sozioökonomische Funktion unserer Arbeit – Zusammenhänge, die unseren Gegenübern oft schlicht nicht bewusst sind und deshalb von uns dargestellt werden müssen. Das Befördern von Konflikten ist dabei unnötig, denn, wie es Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, es augenzwinkernd formuliert hat: »Wir sind die ›Guten‹ – uns finden eigentlich alle toll«. Daraus darf aber nicht abgeleitet werden, dass die ›Anderen‹ die ›Bösen‹ sind. Niemand agiert prinzipiell böswillig, aber vielen fehlt es an Informationen und Sensibilität für die Bedürfnisse unserer Berufsgruppe.
Hilfreich ist es, auf bisher schon geleistete berufsständische Arbeit zurückzugreifen, etwa auf die Honorarempfehlungen der DOV (Deutsche Orchestervereinigung) für freiberufliche Musikerinnen und Musiker, in denen Mindeststandards für Proben und Konzerte formuliert werden. Eine betriebswirtschaftliche Rechnung, wie sie der SMPV (Schweizerischer Musikpädagogischer Verband) auf seiner Webseite empfiehlt, kann neben einer Darstellung der oben beschriebenen örtlichen Besonderheiten erfolgreichere Honorarverhandlungen ermöglichen. Auch in weiteren Nachbarländern gibt es positive Entwicklungen, die es sich zu beobachten lohnt, wie etwa die Arbeit des in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiven Vereins »art but fair«. Letztlich sind wir eine internationale Branche, agieren im Hinblick auf die Interessen unseres Berufsstand aber noch weitgehend auf regionaler Ebene. Zunächst jedoch müssen wir uns realistische Ziele setzen, die sich auf unser Bundesland Berlin beziehen, und den Fokus dann auf nationale und internationale Gegebenheiten erweitern.
Mittelfristig bestünde ein wichtiger Schritt zu einem verbesserten Zusammenwirken der bestehenden Strukturen in der Bündelung aller kulturellen Verbände und Organisationen in einem (noch zu gründenden) Berliner Landeskulturrat, idealerweise mit eigenem Personal und einem stabilen Budget, das unabhängiges Handeln ermöglicht. Auf Bundesebene gibt es bereits den Deutschen Kulturrat, der als Spitzenverband der Bundeskulturverbände auch den Deutschen Musikrat als eine von mehreren Sektionen einschließt. Hier existieren professionelle Verwaltungsstrukturen, die gemessen an ihren Aufgaben zwar eigentlich unzureichend ausgestattet sind, aber dennoch sehr effektive Arbeit leisten – beispielsweise geht die Einrichtung des Amtes des Kulturstaatsministers auf die Arbeit des Deutschen Kulturrates zurück.
Denkt man noch weiter in die Zukunft, so wäre die Gründung einer Kammer für Musik anzustreben, also einer berufsständischen Körperschaft, wie sie die Ärzte, Apotheker, Rechtsanwälte, Architekten, Steuerberater, Handwerker und viele andere Berufsgruppen längst haben. (Es wäre sogar eine Kammer für alle Kulturberufe vorstellbar, die eine Kammer für Musik als eine von mehreren Sektionen einschlösse.) Wie oben dargestellt, existiert bisher keine offizielle Stelle, an der die Interessen und Meinungen unserer Kollegenschaft gebündelt und Entscheidungen im Sinne unseres Berufsstands getroffen werden können. Eine Kammer für Musik würde als kraftvolle berufsständische Vertretung des Berliner Musikertums fungieren. Auf den genannten Gebieten könnte sie eine stabile Organisationsstruktur für alle Anliegen der Musikausübung und musikalischen Ausbildung bereitstellen und wäre Kristallisationspunkt für alle diesbezüglichen Fragen. Vertreter aus den Ausbildungsinstitutionen und aus der Kultur- und Bildungspolitik könnten sich ebenso wie einzelne Mitglieder sich an die Kammer wenden und darauf zählen, dass ihre Anliegen professionell bearbeitet werden. Eine Kammer für Musik könnte beispielsweise auch Empfehlungen für zukünftige Ausbildungsinhalte aussprechen, die auf aktuelle Entwicklungen im Musikmarkt Bezug nehmen, und – ein sehr wichtiger Punkt – eine verbindliche Gebührenordnung für musikalische Dienstleistungen und Musikunterricht erarbeiten und verabschieden. Darüber hinaus könnte eine Kammer einen Schutz der Berufsbezeichnungen »Musikerin«, »Instrumentalpädagoge«, »Gesangslehrerin« etc. erwirken und verteidigen, so dass entsprechende Titel nur bei Vorliegen einer qualifizierten Ausbildung verwendet werden dürften. Diese Szenarien klingen im Moment noch wie Zukunftsmusik, sind aber langfristig erreichbar, wenn wir unsere Bemühungen konzertieren und kanalisieren.
IV. Kanäle zur Vernetzung
Wir danken Euch, dass Ihr dieses lange Schreiben bis zum Ende gelesen habt. Es war uns wichtig, die komplexen Zusammenhänge möglichst verständlich und in angemessener Ausführlichkeit darzustellen. Damit dieser Appell nicht verpufft, seid Ihr nun gefragt. Informiert, engagiert und vernetzt Euch! Wir haben eine Liste von Organisationen und Verbänden erstellt, bei denen Ihr Euch persönlich einbringen könnt. Aber auch in Euren Institutionen ist das in der Regel schon jetzt möglich. Wenn es nicht bereits Zusammenschlüsse oder Interessenvertretungen gibt, könnt Ihr selbst welche gründen. Natürlich könnt ihr uns auch gern persönlich kontaktieren. Wir brauchen Euch!
- Deutscher Tonkünstlerverband (DTKV), Landesverband Berlin – www.dtkv-berlin.de
- Deutsche Orchestervereinigung (DOV) – www.dov.org
- Landes-Lehrervertretung der Berliner Musikschulen (LBM) – www.lbm-online.de
- Bundesverband deutscher Privatmusikschulen (BDPM) – www.bdpm-musikschulverband.de
- Verein »art but fair« – www.artbutfair.org
- Landesverband freie darstellende Künste Berlin e.V. (LAFT) – www.laft-berlin.de
- Koalition der Freien Szene Berlin – www.berlinvisit.org
- Rat für die Künste Berlin – www.rat-fuer-die-kuenste.de
- Bundeskonferenz der Lehrbeauftragten an deutschen Musikhochschulen (BKLM) – www.bklm.org
- Fachgruppe Musik der Vereinigten Dienstleistungs Gewerkschaft (ver.di) – www.musik.verdi.de
- Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) – www.gew.de
- Facebook-Gruppe Berliner Musikschullehrer – https://web.facebook.com/berlinermusikschullehrer
Die Autoren
Helge Harding (hh@helge-harding.com) – Dirigent und Klarinettist, unterrichtet Klarinette an der Universität der Künste und an der Musikschule »Fanny Hensel« Berlin-Mitte. Vielseitige, auch internationale künstlerische Tätigkeiten. Nebenberuflich politisches und berufsständisches Engagement. Mitglied des Vorstandes des DTKV Berlin. Lebt in Berlin-Neukölln.
Wendelin Bitzan (wen.de.lin@web.de) – Musiker und Musikforscher, unterrichtet Musiktheorie und Gehörbildung an der Universität der Künste Berlin, an der Musikhochschule »Hanns Eisler« und an der Humboldt-Universität zu Berlin. Freiberuflicher Komponist und Autor; Publikationen zur Musiktheorie und Musikpädagogik. Mitglied im DTKV Berlin. Lebt mit seiner Familie in Berlin-Wedding.
Ähnliche News
-
16. November 2024
Bundesdelegiertenversammlung 2024 -
8. Oktober 2024
Aktionstag #BerlinIstKultur am 16.10.2024 -
15. April 2024
Treffen mit Antje Valentin beim DMR -
26. März 2024
PM: Lehrtätigkeiten an Berliner Musikschulen -
14. Dezember 2023
Kürzungen drohen an Musikschule Neukölln -
6. November 2023
Bundesdelegiertenversammlung 2023 -
13. Oktober 2023
Stellungnahme des DACH Musik zum Haushaltsentwurf